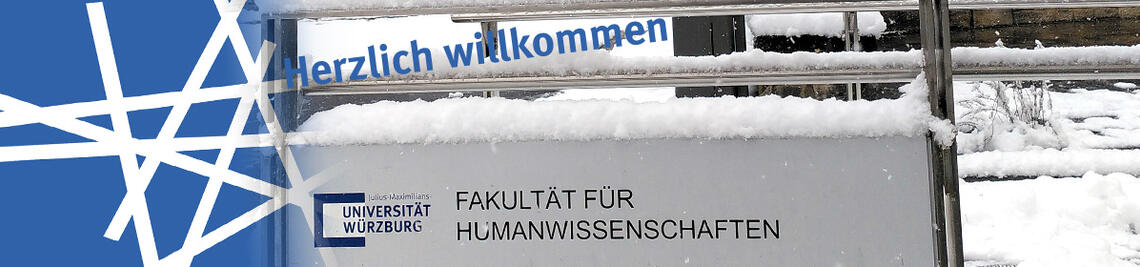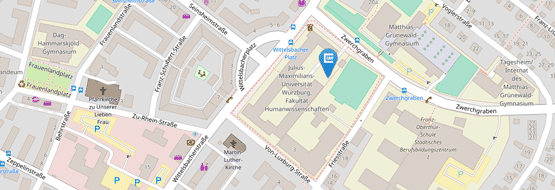And the winners are.... Gleich zwei mal Science Slam zum Jubiläum!
13.11.2025Insgesamt um die 1600 Wissbegierige lauschten vergangenes Wochenende Forschenden auf der Bühne. Denn der Würzburger Science Slam hat sein zehnjähriges Bestehen im Z6 an der Uni Würzburg gefeiert. Dr. Isabell Ramming und Prof. Dr. Hans-Georg Weigand sind die glücklichen Gewinner der beiden gelungenen Abenden.

Das Jubiläum startete Freitag mit dem klassischen Slam
Standpunkte zu wissenschaftlichen Themen unterhaltsam und verständlich vermitteln: Zum zehnten Mal sind Slammerinnen und Slammer aus der Wissenschaft am Campus der Julius-Maximilians-Universität (JMU) gegeneinander angetreten. Während am ersten Abend sieben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegeneinander antraten und eine Siegerin gekürt wurde, kamen am Best-of-Abend Siegerinnen und Sieger der vergangenen Jahre zusammen. Die beiden Science Slams organisierten die Uni Wü Community der JMU zusammen mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) und der Stadt Würzburg. Der Erlös der Abende fließt in das Deutschlandstipendien-Programm.
Für die Slammerinnen und Slammer geht es darum, verschiedene Wissenschaftsfelder in jeweils sieben Minuten zu präsentieren. JMU-Alumnus Johannes Keppner moderierte den Abend und fand: „Alle Teilnehmenden haben Ehre und Respekt verdient, dass sie sich der Aufgabe stellen.“
Dr. Isabell Ramming bekam den lautesten Applaus und wurde zur Siegerin gekürt
Die Gewinnerin des Science Slams 2025, Dr. Isabell Ramming, setzte sich mit der Frage „ESKAPE – (Wie) Entkommen wir Krankenhauskeimen?“ auseinander. Die Mikrobiologin am Lehrstuhl für Krankenhaushygiene der JMU sprach aus Perspektive eines Bakteriums zu den Teilnehmenden und begann mit einem Gedicht über den „enterococcos faecium“, der ein Teil der physiologischen Darmflora von Menschen und Tieren ist. Sogenannte Membranvesikel sitzen als Bläschen an solchen Bakterien. Dr. Ramming brachte in kurzweiligen Beispielen dem Publikum näher, wie eine Laboruntersuchung eines solchen Membranvesikels vonstattengehen könnte.
Science Slam: Sieben x Sieben Minuten Wissensvermittlung
Den Anfang beim Jubiläumsslam machte der Vorjahressieger Prof. Dr. Hannes Taubenböck, Fachbereich Geographie der JMU, mit seinem außer Konkurrenz stehenden Slam „Ich sehe was, was du nicht siehst“. In seiner Arbeit nutzt er Satellitenbilder aus dem All und wertet diese Daten aus. „Damit können wir verstehen, wie die Menschheit unseren Planeten nach ihren Bedürfnissen umgestaltet.“ Aus der Vogelperspektive präsentierte er Fotos von bebauten Flächen. „Diese Art der Erdbeobachtung ist grandios, weil wir dadurch die Entwicklungen der Zeit sehen können.“
Am eigentlichen Wettbewerb 2025 nahmen neben der Siegerin teil:
- Jessica Ruck (Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin des Instituts für Allgemeinmedizin des Uniklinikums Würzburg): „Lost in prevention – Nicht-intendierte Effekte von Gesundheitskommunikation am Beispiel der Präventionskampagne ,Legal aberʼ des Bundesgesundheitsministeriums“
- Dr. Volker Latussek (Physiker und Mitarbeiter der JMU-Zentralverwaltung im Bereich Planung und Berichtswesen): „Warum sind Drittmittel nicht unanständig?“
- Prof. Martin Naumann (Professor für Entwerfen und Architekturtheorie sowie Vizepräsident Nachhaltigkeit und Infrastruktur): „Ein paar Thesen zur Nachhaltigkeit“
- Prof. Dr. Peter Bofinger (Uni-Seniorprofessor für VWL, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen der JMU sowie Vorstandsvorsitzender des zentralen Alumni-Vereins der Uni): „Reichwerden mit Krypotwährung?“
- JMU-Alumnus Dr. Gunther Schunk (Linguist und Director Public Relations Vogel Communications Group sowie Vorstandsvorsitzender der Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp und Vorsitzender des Unibundes Vogel Medien): „Meefränggisch – sprachökonomische Identitätsstiftung als Superpower“
- Carsten Büchner (Doktorand der Physik am Würzburger Fraunhofer Institut): „Silicatforschung ISC: Zuhören und verstehen: Wie geht es eigentlich unseren Batterien?“
Über die einzelnen Slams
Jessica Ruck machte mit ihrem Slam den Auftakt für den Wettbewerb. Unter dem Motto „Lost in prevention – Nicht-intendierte Effekte von Gesundheitskommunikation am Beispiel der Präventionskampagne ,Legal aberʼ des Bundesgesundheitsministeriums“ zeigte sie humorvoll Auswertungen von Instagram-Beiträgen über die Legalisierung von Cannabis im vergangenen Jahr mit Fokus auf die Präventionskampagne des ehemaligen Gesundheitsministers Karl Lauterbach. Prävention bedeutet die Vermeidung und Verringerung von Krankheit bzw. den Erhalt von Gesundheit. „Diese Kampagne war gut gemeint, jedoch nicht gut gemacht“, schloss Jessica Ruck. Die Kampagne stünde als Paradebeispiel dafür, wie halbherzig Präventionskampagnen in Deutschland umgesetzt würden. „Jugendliche sollten dabei unterstützt werden, ihre Ressourcen zu entfalten, anstatt sie ihnen abzusprechen“, so ihr Resümee.
Dr. Volker Latussek beantwortete in sieben Minuten die Frage: „Warum sind Drittmittel nicht unanständig?“ Bayerische Hochschulen werden drittmittelfinanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) – Deutschlands größte Forschungsförderorganisation. Auch vom Bund, der EU, der Wirtschaft, von Stiftungen oder Privatpersonen werden Drittmittel finanziert. Dr. Latussek erklärte: „Deutschlandstipendien, die durch den Erlös des Ticketverkaufs der Science Slams gefördert werden, sind zum Beispiel nicht drittmittelfinanziert.“
Für die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) ging dieses Jahr Prof. Martin Naumann ins Rennen. Er präsentierte „Ein paar Thesen zur Nachhaltigkeit“, indem er in seinem Beitrag Gedanken über „das gute Leben für alle“ teilte. Nachhaltigkeit sei aber weder eine Disziplin, noch ein Studiengang. „Nachhaltigkeit ist eine Haltung“, so Prof. Naumann. Er appellierte dazu, mutig nach vorne zu schauen, denn die Zukunft sei bereits da. Der Weg entstünde, indem man ihn gehe. Potenziale und Möglichkeiten sollten genutzt werden.
Prof. Dr. Peter Bofinger trat mit seinem Thema „Reichwerden mit Kryptowährung?“ vor das Publikum. Es gebe rund 17.000 Kryptowährungen, die bekannteste sei der Bitcoin. Mittlerweile seien rund 20 Milliarden dieser Bitcoins auf dem Markt. Prof. Dr. Bofinger erklärte, wie Spekulation funktioniere: „Ich kaufe etwas, um es weiterzuverkaufen – egal, ob ich tatsächlich überzeugt von diesem Produkt bin.“ Kryptowährung bedeute demnach „einen Anspruch zu haben auf Nichts.“
Dr. Gunther Schunk, stellte den Teilnehmenden „Meefränggisch – sprachökonomische Identitätsstiftung als Superpower“ vor und hob die Wichtigkeit der Dialekte hervor: „Dialekt bietet Kommunikation und trägt die Mentalität und Weltsicht einer ganzen Region.“ Dialekt sei dabei räumliche Verortung und lasse sich nicht von künstlicher Intelligenz kapern. Gerade in Zeiten der Technologie dürfe das Menschliche nicht vergessen werden. Der Autor des Asterix-Bandes „Asterix auf Meefränggisch“ hatte das Lachen des Publikums mit seinem „Fränkischen 8-G: Biggniggruggsagg“ auf seiner Seite.
Carsten Büchner brachte dem Publikum „Silicatforschung ISC: Zuhören und verstehen: Wie geht es eigentlich unseren Batterien?“ näher. Er visualisierte die Höhe einer Ultraschallfrequenz, nicht hörbar für das menschliche Ohr. „Schallgeschwindigkeit etwa ist im wassergefüllten Raum schneller als in der Luft“, so Carsten Büchner. In seiner Forschung arbeitet er mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien und möchte herausfinden, wie sich ihre Lebensdauer verlängern lässt, ihre Nutzung effizienter gestaltet und das Recycling verbessert werden kann. „Batterien“, so sein Fazit, „werden im Hinblick auf den Klimawandel immer wichtiger. Wir müssen wegkommen von der Verbrennung fossiler Brennstoffe, hin zu erneuerbaren Energien.“ Hierfür spiele die Speicherung von Energien in Batterien eine erhebliche Rolle.“
Zusammenfassung von Angela Kreipl, Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Samstag ging es weiter mit dem Best Of
Was verbindet Bandwürmer, die Gedankengänge eines Mathematikers und Quantenteilchen, die gleichzeitig in Würzburg und Schweinfurt leben? Sie alle tauchten in den unterhaltsamen Vorträgen bei der Best-of-Ausgabe des Würzburger Science Slams am Samstag, 8. November 2025, auf. Dieser feierte im Hörsaalgebäude Z6 der Julius-Maximilians-Universität (JMU) sein zehnjähriges Bestehen.
Die Besonderheit in diesem Jahr: Die Jubiläumsausgabe wurde zusätzlich zum jährlich stattfindenden Science Slam ausgerichtet. An zwei Abenden begeisterten 14 Forschende insgesamt 1600 Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren Projekten. Sieben Siegerinnen und Sieger vorangegangener Ausgaben traten beim Jubiläum auf und hatten sieben Minuten Zeit, um das Publikum zu unterhalten. Dabei galt: Der lauteste Applaus kürt die Gewinnerin oder den Gewinner.
Jubiläumssieger durfte sich an diesem Abend Professor Hans-Georg Weigand nennen, früherer JMU-Professor für Didaktik der Mathematik. Mit seinem humoristischen Blick in das Gehirn eines Mathematikers und wie dieses an mathematische Aufgaben herangeht, entschied er die Gunst des Publikums für sich.
Über Quantenteilchen, Angry Birds und Pokémon
Eröffnet hat den Science Slam Professor Björn Trauzettel, Leiter des JMU-Lehrstuhls für Theoretische Physik IV. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht zu erklären, warum es quantenmechanische Teilchen leichter im Leben haben. Eine der Antworten: Die Teilchen haben keine Terminkonflikte wie Menschen, da sie zur gleichen Zeit sowohl in Schweinfurt als auch in Würzburg sein können.
Technisch ging es weiter mit Professor Daniel Kulesz von der Technischen Hochschule Bingen. Die 49 Präsentationsfolien des Informatikers zeigten, wie man Nicht-Informatikern ermöglicht, eigene Computer-Software zu erstellen und qualitativ zu optimieren. Seine Lösung beinhaltete, mit Verweis auf die Angry Birds Spiele-Reihe herkömmlichen Spreadsheet-Formaten wie Microsoft Office Excel „den ganz großen Vogel“ zu zeigen.
Den Erklärungsweg über eine Videospielreihe wählte auch Dr. Sebastian Markert, Ingenieurwissenschaftler an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Ihm dienten dazu die berühmten Pokémon. Er stellte sich die Frage, was eigentlich passiert, wenn Menschen ihre Augen schließen. Wie ein Pokémon, dass mit jeder neuen Entwicklungsstufe plötzlich mehr Besteck in Form von Löffeln erhält, befeuchtet sich das Auge im Moment des Blinzelns mit einem Sturzbach an Wasser.
Shakespeare zitierende Bandwürmer
Paul Pauli, Präsident der Universität Würzburg, richtete nach der Pause sein Wort an das Publikum. Er betonte, wie wichtig das Format Science Slam sei, vor allem in Zeiten, in denen „immer mehr Zweifel an Wissenschaft“ an Boden gewinnt. Auch die Exzellenzstrategie der JMU griff er auf. Zur Erklärung dieses Prozesses bekam das Publikum Videos gezeigt, produziert von der Pressestelle der Uni, die das Prozedere niedrigschwellig und auf Studierende zugeschnitten erklären.
Ernster wurde es bei Dr. Julien Bobineau, Publizist und Mitglied der Geschäftsleitung der Denkfabrik Diversität. Er behandelte Racial Profiling bei der Polizei und wie präsent koloniale Stereotypen heute noch im Alltag sind. Zum Beispiel wissen viele vermutlich nicht, dass das Lied „Drei Chinesen auf dem Kontrabass“ seine Ursprünge um 1900 hat und eigentlich „Drei Japaner ohne Pass“ hieß.
Im Anschluss ging es auf WG-Suche mit Charlotte Schwenner. Nicht die Wissenschaftsredakteurin suchte ein neues Zuhause, sondern Bakterien. Ein kuscheliges Heim finden die Mikroben unter anderem in unaufgeräumten WG-Küchen von Studierenden. Das stellt besonders dann eine Gefahr dar, wenn es sich um Antibiotika-resistente Bakterien handelt.
Den Abschluss markierte Professor Klaus Brehm, Parasitologe am JMU-Institut für Hygiene und Mikrobiologie, mit einer dramatischen Einlage à la William Shakespeare. Brehms umgeschriebenen Hamlet-Dialog präsentierte jedoch nicht der dänische Prinz aus dem Theaterstück, sondern ein Bandwurm im Verdauungstrakt seines Wirts.
Zusammenfassung von Martin Brandstätter, Universität Würzburg